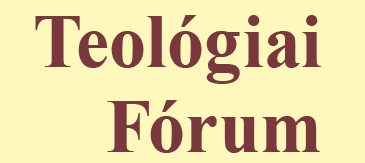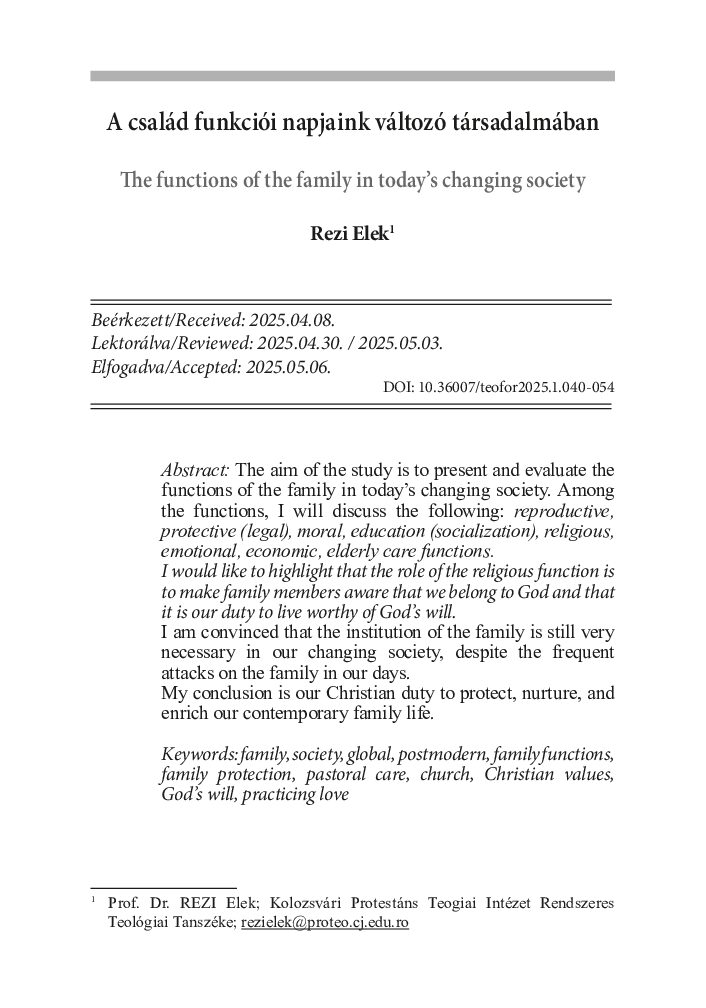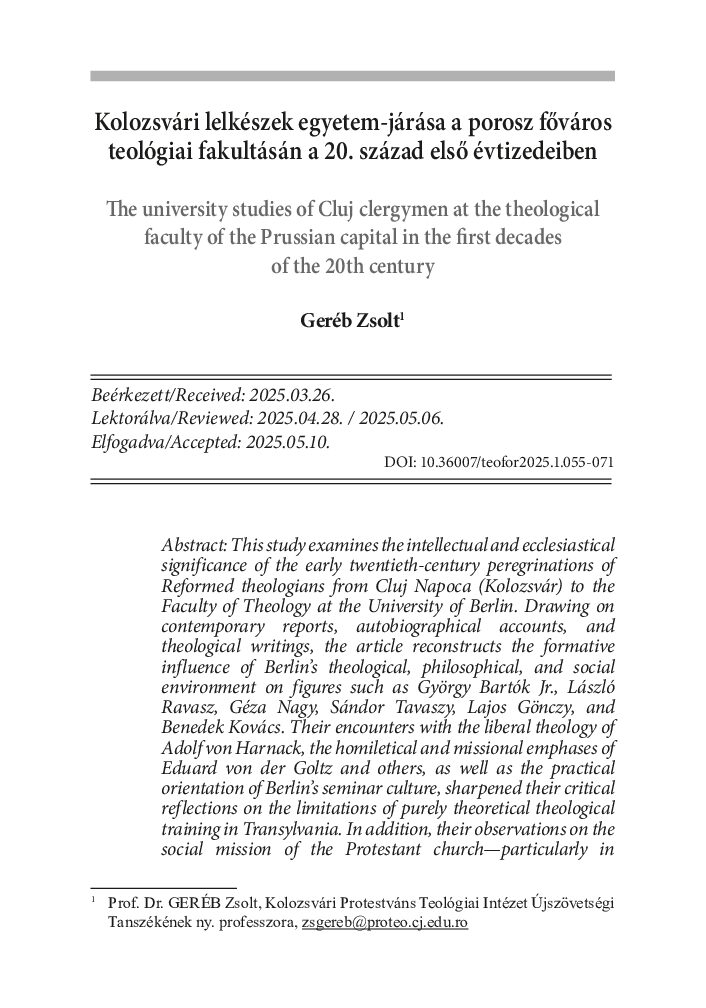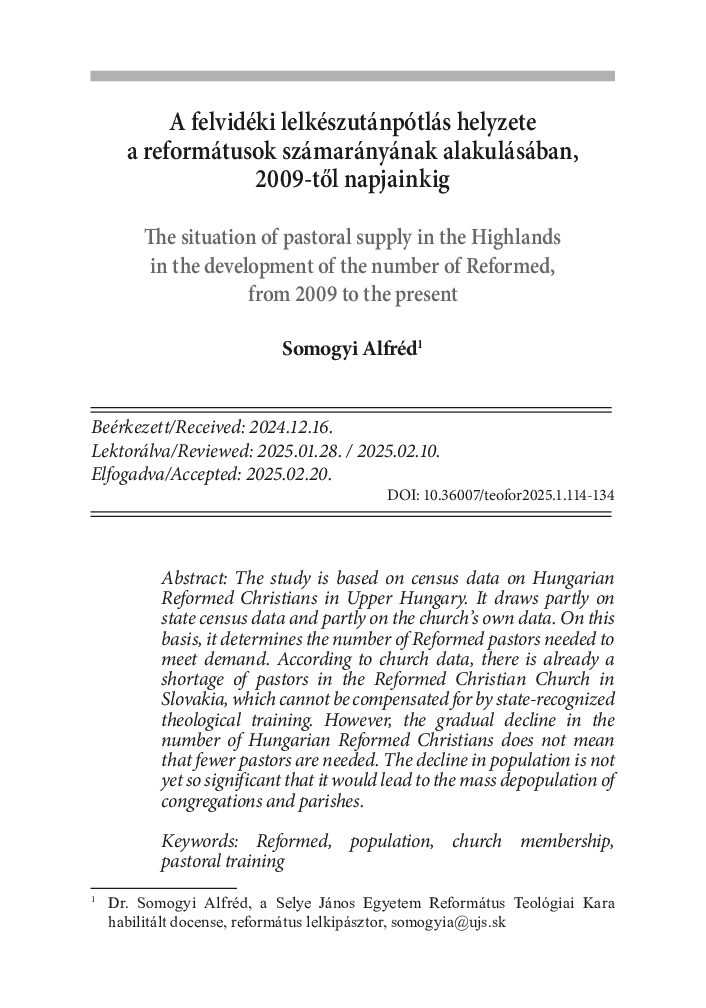Die Schwierigkeit bei der Recherche zu diesem Thema lag in der Knappheit der Quellen. Selbst diejenigen, die verfügbar waren, lieferten nur sehr wenige
Informationen. Unser Ziel war es, einen Einblick in die Alphabetisierung der Ehefrauen von Geistlichen im 16. und 17. Lange Zeit war die Möglichkeit, sich zu bilden, ein Privileg der Oberschicht. Im Gegensatz dazu ist bekannt, dass viele adlige Frauen und Herren im 16. Jahrhundert nicht schreiben konnten. Bis zum 17. Jahrhundert war dieses Defizit in den meisten Adelsfamilien aufgeholt, und auch das Bürgertum hatte bis dahin erhebliche Anstrengungen unternommen, um
in Sachen Alphabetisierung aufzuholen, was in ihrem Fall auch die Fähigkeit zum Lesen und Schreiben einschloss. Die Töchter der unteren Gesellschaftsschichten bereiteten sich vor allem im Elternhaus, meist an der Seite ihrer Mütter, darauf vor, gute Ehefrauen, Hausfrauen und Mütter zu sein. Aufgrund der spärlichen Quellenlage konnten wir in den meisten Fällen nur den Namen der Frau des Predigers herausfinden. Glücklicherweise konnten wir in den Fällen, in denen wir in der Lage waren, die Abstammung, den sozialen Status und den Beruf der Eltern herauszufinden, auch feststellen, ob die Auserwählte eine Jungfer oder eine Witwe war. Die Herkunft, der soziale Status und der Beruf der Eltern lieferten einige Anhaltspunkte für unsere Diskussion über das
Thema. In mehreren Fällen lieferten die Quellen eindeutige Informationen über die Ausbildung der Ehefrau, während wir uns in anderen Fällen nur auf Rückschlüsse verlassen konnten. In den Fällen, in denen uns Informationen zu unserem Thema fehlten, können wir jedoch sagen, dass es sich mit wenigen
Ausnahmen um gebildete Frauen handelte, wenn auch nicht um gebildete. Dies gilt umso mehr, als im 16. und 17. Jahrhundert bei der Wahl eines protestantischen Pfarrers nicht die Bildung seiner künftigen Frau im Vordergrund stand, sondern Weisheit, Lebenserfahrung, Frömmigkeit und die Tugenden einer Hausfrau, Mutter und guten Ehefrau. Und wenn all dies durch andere Kenntnisse ergänzt wurde, war das nicht nur für den Ehemann, sondern auch für die Kinder und ihre Umgebung ein Mehrwert.
Konzepte: Frauenerziehung, Ehe, Bildung, 16. bis 17. Jahrhundert, Protestantismus